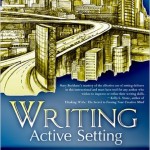Irland, eine Insel der Mythen. Normalerweise eine geeignete Kulisse für eine Fantasy-Story. Aber was ist schon normal, wenn man im Fundus von Zuschussverlagen stöbert? Sehen Sie, was ich gefunden habe.
Etwas Geeignetes für diesen Blog zu finden, ist teilweise sehr schwierig. Ich will nicht absoluten Schrott präsentieren, sondern etwas zwischen Schrott und Anfängerfehlern, das als Lehrbeispiel dienen kann. In letzter Zeit fand ich nur Schrott. Das folgende Beispiel ist zumindest leicht besser und zeigt, welche Lücken fehlende Beschreibungen der Kulisse beim Leser hinterlassen. Nebenbei taucht noch der übliche Fehler: „Recherche? Ist unnütz“ auf. Ferner liebt die Autorin das Ausrufezeichen.
Worum geht es in der Handlung? Es soll ein Fantasy-Roman sein. Eine in Deutschland lebende junge Frau irischer Abstammung will die Heimat ihrer Vorfahren erkunden. Sie ergattert einen Studienplatz in Dublin – für welches Fach braucht der Leser anscheinend nicht zu wissen, es wird nirgends erwähnt. Praktischerweise wohnt eine Großtante in Blessington, das liegt nur ca. 35 km von Dublin entfernt. Dort kann die junge Frau wohnen. Das erscheint noch stimmig. Irgendwie wird es aber danach sehr haarig, denn der Plot verlangt von der Romanfigur eine fünfstündige Busfahrt nach Dunquin, das liegt an der Atlantikküste. Dort muss die junge Frau unbedingt auf eine – angeblich – unbewohnte Insel. Wie sie von dort aus in Dublin studieren soll, ist mir zwar ein Rätsel, aber das ist nicht das einzige Fragezeichen dieses „Romans“. Besagte Insel heißt Blasket Island und ist eine Touristenattraktion. Die Fantasy ging der Autorin leider ziemlich durch, denn sie macht daraus eine verfluchte Insel, die niemand besucht, wo keine Fähre anlegt und dauernd Menschen verschwinden. Gähn!
Schon fünf Minuten bei Google erzählen zu Blasket Island ganz andere Dinge, aber Fakten werden heutzutage ohnehin überbewertet. Vielleicht schreibt ja gerade ein Ire eine Fantasy-Story über Schloss Neuschwanstein, in der es niemand besucht, keine Straße hinführt und jeder Angst hat, auch nur in die Nähe zu kommen. It´s fantastic.
Aber kommen wir zu dem was man von dem Text lernen kann: Wie blutleer eine Geschichte ist, wenn die Kulisse in keinster Weise geschildert wird. Die Romanfigur ist gerade in Irland angekommen, ich vermute Dublin, aber selbst das wird dem Leser verschwiegen. Der Originaltext ist in Kursiv, meine Bemerkungen stehen in eckigen Klammern.
Ich steuerte nach dem Verlassen des Flughafengebäudes auf den öffentlichen Bus zu; meine notwendigsten Sachen hatte ich in einem Rucksack verstaut, meine Koffer schloss ich vorerst in einem Schließfach ein, die könnten wir später immer noch abholen. Die Fahrt war erholsam, ich betrachtete die vorbeiziehende Landschaft.
[Wie sieht die aus? Die Protagonistin ist das erste Mal im Leben in Irland. Welche Eindrücke hat sie? Wie riecht es, welche Leute sitzen im Bus? Welche Gedanken gehen ihr durch den Kopf?]
Das Wetter war typisch für Irland, in den fünf Stunden, die ich im Bus verbrachte, regnete es mindestens vier Mal, dann schien wieder die Sonne.
[Das sagt dem Leser immer noch nichts über Irland. Schlechtes Wetter ist ein Klischee, das man mit mehr Leben füllen kann. Die Protagonistin muss fünf Stunden fahren, bis sie ihren Zielort erreicht. Das macht sie ohne Koffer, weil man die später wieder abholen kann? Übertragen wir das auf Deutschland. Ich komme am Flughafen München an, fahre zu fünf Stunden entfernten Verwandten, die natürlich gerne mit mir wieder fünf Stunden zurückfahren um meine Koffer zu holen? Das macht einen zehn-Stunden-Tag allein für die Kofferbeschaffung. Dafür braucht man außerordentlich liebenswürdige Verwandte. Meiner Ansicht nach ist es ein Plotfehler der Form: Die Protagonistin soll ohne Koffer ankommen, deshalb sauge ich mir aus den Fingern, dass …]
Plötzlich ertönte eine Stimme aus dem Lautsprecher: [Wie hätte man das Wort „Plötzlich“ vermeiden können?]
„Dunquin, Endstation, bitte alle aussteigen[ ! ] “ Erwartungsvoll stieg ich aus und lief Richtung Hafen. Obwohl ich schon den ganzen Tag unterwegs war, war ich begierig, noch vor Einbruch der Dunkelheit Blasket Island zu erreichen. Dazu wollte ich eine Fähre nehmen, also beabsichtigte ich mich nach den Abfahrtszeiten zu erkundigen. Ich betrat das Besucherzentrum, eine ältere Dame schaute auf und zog die Augenbrauen hoch, als sie mich sah.
[Irgendwie kann ich mir weder den Ort Dunquin (ein kleines Dorf mit nur 170 Bewohnern ) noch die Besucherhalle vorstellen. Welchen Eindruck hat die Protagonistin vom Ort, von der alten Dame? Das Besucherzentrum in Dunquin ist übrigens ein moderner Glaspalast.]
„Verzeihung, könnten Sie mir bitte Auskunft geben, wann die nächste Fähre nach Blasket Island fährt?“, versuchte ich mich in irischem Akzent.
Das Gesicht der Frauengestalt hinter der Glasscheibe verblasste zunehmend, die Brille rutschte ihr von der Nase, hätte sie nicht an einer Kette gehangen, sie wäre wohl zu Boden gefallen und zerbrochen.
[Die alte Frau sitzt also hinter einer Glasscheibe? Wenigstens etwas, das man über das Setting erfährt]
„Blasket Island?“, fragte sie ungläubig, als hätte sie mich nicht richtig verstanden.
Ich nickte bedeutungsvoll. [Wie nickt man eigentlich un-bedeutungsvoll?]
„Da fährt weder eine Fähre noch sonst irgendetwas hin, junge Dame.“ Sie sah mich spöttisch an. [Telling statt Showing. Wie sieht der Spott aus? Welche Mimik verwendet die alte Frau? Woran merkt die Protagonistin, dass man sie spöttisch anblickt? Nebenbei bemerkt: Die Antwort der alten Frau ist falsch. Richtig müsste es heißen: „Es gibt einen regelmäßigen Fährverkehr nach Blasket Island. Direkt vom Dunquin Hafen aus. Es ist ein zweimotoriges Boot mit einer Kapazität von 50 Personen. Haben Sie den Trip vorab im Internet gebucht? In der Hochsaison ist das zu empfehlen.“]
Meine irische Aussprache durfte also doch nicht so schlecht gewesen sein.
„Aber ich muss dorthin[ ! ] “, stieß ich verzweifelt aus. [Telling statt Showing. Wie merkt der Leser die Verzweiflung der Protagonistin? Wie kann er es spüren?]
„Sie müssen lebensmüde sein, um dorthin zu wollen[ ! ] Wie gesagt, sie werden niemanden finden, der Sie dorthin bringen wird[ ! ] “ Ich wollte schon kehrtmachen, da eröffnete sie mir: „Es sei denn, Sie versuchen es unten am Hafen bei Paddy, der ist verrückt genug, um Sie dorthin zu fahren.“
Sie verzog ihre Mundwinkel und schüttelte den Kopf über mich.
„Vielen Dank“, platzte es aus mir heraus, und sogleich schlüpfte ich bei der Tür hinaus.
An der Anlegestelle machte sich gerade einer der Fischer an seinem Netz zu schaffen, sonst konnte ich niemanden weit und breit auf dem Gelände sehen. [Wie sieht das Gelände aus? Der Fischer ist momentan nur eine Pappfigur, die Paddy heißt.]
„Ähm, verzeihen Sie bitte, sind Sie Paddy?“
„Wer lässt fragen?“
„Ähm, mein Name ist Maire O’Neill.“ Ich lächelte schüchtern. [Telling statt Showing]
„Und?“ Er war nicht besonders gesprächig. [Telling statt showing]
„Ich wollte nach Blasket Island, und die Dame im Besucherzentrum sagte mir, Sie würden mich vielleicht dorthin bringen.“
„Sagte sie das? Aha.“
„Können Sie nun?“
„Was willst du denn dort, Mädchen?“, fragte er mich genervt. [Telling statt Showing. Wie hätte man das „Genervt sein“ zeigen können? Gestik?]
„Meine Großeltern lebten dort, vor vielen Jahren“, ergänzte ich.
„Wie war dein Name? Maire O’Neill?“
„Ja, Sir“, stammelte ich.
„Hör zu, Maire, auf Blasket landen schon seit langer Zeit keine Boote mehr, es ist ausgestorben, niemand wohnt mehr dort, die letzten Bewohner verließen die Insel, nachdem sich dort immer wieder höchst merkwürdige Vorfälle ereignet hatten. Man erzählt sich, dass der Geist des toten Earls nachts sein Unwesen auf Blasket Island treibt. Höchstens ein paar durchgeknallte Touristen kommen manchmal auf die Idee, dort rüberzuschippern[ ! ] Und glaube mir, ich habe noch keinen Einzigen von dort zurückkehren sehen[ ! ] Bas“, sagte er.
Ich schreckte auf und trat einen Schritt zurück. Das hieß auf Irisch Tod[ ! ]
[Unglaubwürdige Theatralik. Menschen verschwinden in aller Öffentlichkeit auf einer in der Realität massenhaft besuchten Insel und jeder legt den Mantel des Schweigens darüber?]
Dann fasste ich mich wieder und stieß energisch hervor: [Auch auf die Gefahr mich zu wiederholen: Wie sieht dieses „Energisch sein“ denn genau aus?] „Leihen Sie mir wenigstens ein Boot?“ Langsam hatte ich von dieser Art der Unterhaltung genug [ ! ] Er sah mich mit in Falten gelegter Stirn an und entgegnete mir: „Das dort drüben kannst du haben, ich brauche es nicht mehr.“
„Was wollen Sie dafür haben?“, fragte ich schroff. [Wie sieht das „Schroff sein“ aus?]
„Nichts, Mädchen, Gott beschütze dich [ ! ]“, schüttelte er verständnislos den Kopf. Bevor er es sich wieder anders überlegen konnte, steuerte ich auf das Boot zu, befreite es rasch von seinem Anker, bestieg es, ließ den Motor an und raste, so schnell mich das Boot tragen konnte, davon.
Unglaubwürdig. Diese Problemlösung der Form „Gutmütiger Fischer verschenkt altes Boot an ihm völlig unbekannte Person“ ist arg konstruiert. Ein paar Euro wird es ja wohl wert sein. Wieso verschenkt man das?
Was fällt an dem Text noch auf, außer dem häufigen und unnötigen Gebrauch des Ausrufezeichens, welches ich deshalb in Klammern setzte, damit es besser auffällt.
Die Figuren, einschließlich der Protagonistin, sind typische Pappaufsteller. Sie haben keine Gefühle, bzw. höchstens miminale, und sie interagieren auch nicht mit der Umgebung. Sie nehmen von ihr keine Notiz und haben keine eigene Agenda. Die Protagonistin bekommt von der Autorin alle Probleme aus dem Weg geräumt.
Problem Koffer: Abgeben am Flughafen, werden später irgendwann von irgendwem abgeholt, der gerne fünf Stunden einfache Fahrt dafür in Kauf nimmt.
Problem Fähre 1: Die alte Dame in einem für den Leser unsichtbaren Besucherzentrum verweist auf einen alten Fischer als Lösung.
Problem Fähre 2: Der alte Fischer verschenkt ein Boot, welches die Protagonistin natürlich ohne Probleme starten und steuern kann.
Die Autorin scheint keinerlei Recherche zu dem Handlungsort betrieben zu haben. Eine Touristenattraktion kann geheimnisvoll sein, dann muss man das aber unterschwellig zeigen, mit ein paar seltsamen Andeutungen hier und da. Stattdessen wird die Keule einer verfluchten Insel herausgeholt, zu der – im Gegensatz zur Realität – keine Fähre geht, auf der Menschen verschwinden ohne dass es jemanden interessiert usw. Der Plot ist also ganz einfach nur Unsinn.
Ein typisches Werk, das von einem Zuschussverlag über den grünen Klee gelobt wird, im Wissen, dass es ohnehin niemand kauft. Braucht auch keiner zu tun, die Autorin hat schließlich bezahlt, der Verlagsgewinn ist in der Tasche.
Wie hätte man die Erlebnisse der Protagonistin realitätsnah schildern können? Nehmen wir einmal an, sie wäre an einem anderen Ort angekommen. Ebenso klein wie Dunquin, aber eher abseits der üblichen Touristenrouten, ohne Glaspalast als Besucherzentrum. Das wäre mein Vorschlag:
Ich sah mich um. Eine mit Schlaglöchern beschenkte Straße führte die Küste hinunter. Die Häuser duckten sich entlang des Wegs, die Farbe blätterte vom Holz ab, die Dachschindeln bedeckte Moos. Zwanzig Bauten höchstens, ein kleines Kaff. Kannten die hier so etwas wie ein Touristikbüro? Der Bus neben mir fuhr an, eine schwarze Rußwolke hüllte mich ein. Ich hustete, wedelte mit den Händen. Der Bus schaukelte über die kaputte Straße, wurde stetig kleiner und verschwand hinter einer Biegung.
Die nachfolgende Stille schmerzte beinahe in den Ohren. Lediglich das Gekreische der Möwen über mir zeigte Leben an. Ich sah weder Einwohner, noch irgendwelche Tiere. Besaß das Dorf nicht einmal einen streunenden Hund oder eine Katze auf Mäusejagd? Wo war ich gelandet? Würde ich hier überhaupt eine Unterkunft finden?
Ich packte den Griff des Rollkoffers. Die Räder knirschten über dem Asphalt. An einem zweistöckigen Holzhaus, grau angestrichen, zwei winzige Fenster zur Straßenfront, hing ein rotes i. Meine Hoffnung stieg. Falls der Buchstabe für das Wort „Information“ stand, hatte ich zumindest vorläufig gewonnen. Die Türklinke quietschte, als ich sie hinunterdrückte. Mich empfing ein halbdunkler Raum, dessen graue Fliesen selbst einen Krankenhausflur zu einem reizenden Ort machten. Die Einrichtung schien in den 1960er Jahren stehen geblieben zu sein. Eine breite Holzbank sollte wohl Besucher zu einer Pause einladen, doch auf mich wirkte sie nicht nur wegen der eingeritzten Buchstaben und Herzen abstoßend. Die Dorfjugend benutzte sie als Ablageort für benutzte Kaugummis. Gleich drei Exemplare klebten unter der Bank, die sah ich sofort. Mehr wollte ich nicht entdecken.
Eine pummelige Frau lehnte an einem Tresen, redete mit der Angestellten dahinter. Es ging um Dorftratsch, irgendeine gescheiterte Beziehung. Die Angestellte schätzte ich auf über sechzig Jahre, ihre Haare hatte sie zu einem Dutt geformt. Das hochgeschlossene braune Kleid, das nicht einmal meiner Oma gefallen würde, verzierte eine silbern blinkende Brosche. Das hagere Gesicht der Frau erinnerte mich an eine Eule, wozu die Nickelbrille mit dicken Gläsern beitrug. Sie vergrößerte die Augen unnatürlich.
Nach meinem kräftigen Räuspern unterbrachen die beiden ihr Zwiegespräch, die Mienen drückten Ärger aus. Ich kannte diese hochgezogenen Augenbrauen, die Blicke von unten nach oben. Ja, ich trug Jeans mit offenen Knien, mein blondes Haar besaß eine knallrote Strähne und das Lippenpiercing weckte wohl abstoßende Gefühle. Mir war es egal, in einer Großstadt trug man das. Die Meinung der Landpomeranzen interessierte mich nicht.
„Wann fährt die nächste Fähre nach Dark Island?“
Pummelchen kicherte hinter vorgehaltener Hand, während Eulengesicht die Nickelbrille den Nasenrücken nach oben schob.
„Wohin?“
„Dark Island.“
„Da gibt es keine Fähre, weil da niemand wohnt. Touristen wollen da auch nicht hin.“
„Meine Tante wohnt dort.“
Eulengesicht faltete die Hände. Ihr Blick erinnerte mich an eine frühere Lehrerin. Ich fühlte mich erneut wie jemand ohne Ahnung, der trotzdem an der Tafel etwas rechnen sollte.
„Junge Frau, ich weiß nicht, wer Ihnen einen Bären aufgebunden hat, aber auf der Insel gibt es nur Möwen. Für eine Übernachtung kann ich ihnen das Bed & Breakfast von O´Donald empfehlen.“
„Sie serviert leckere Haferkekse“, meinte Pummelchen. So wie sie aussah, waren Kekse auch ihr Lieblingsgericht. Damit hatten sich meine Probleme vergrößert. Ich hasste Haferkekse.
Bildquelle
- Irland: tiramisu studios freedigitalphotos.net